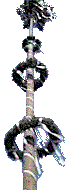|
Kirwa-G'schichten

Scho gwusst?
Ein Amerikaner über die Kirwa - aus dem Buch
"Tief in Bayern" lautet der Titel einer nicht ganz ernst gemeinten Ethnografie des amerikanischen Professors R.W.B. McCormack. In zahlreichen Kapitel wie "Staat", "Sprache", "Denken und Fühlen" beschreibt er das bayerische Volk. Im Kapitel "Trinksitten" kommt er auf die Kirwan zu sprechen:
"'Festivitäten werden hierzulande nicht nur gern mit Bier, sondern oft auch wegen des Bieres begangen'. Bei der Fränkischen Tagespost feierte man 18989 die 100. Hausdurchsuchung mit Bier. Die Krupskaja wunderte sich, daà die bayerischen Sozialdemokraten den 1. Mai mit Kind und Kegel in den Biergärten feierten. Die neu im Festkalender auftauchenden Führerscheinwiedererlangungsparties wären ohne Alkohol gar nicht zu denken.
Bis vor wenigen Jahren hat es in Bayern mehr als achtzig kirchliche Feiertage pro Jahr gegeben. Das Kirchweihfest zog sich über mehrere Tage hin.
A guata Kirta
Dauert Sunnta, Monta und Irta
Und ko si a nu schicka
Bis in Micka
Der Trinker muÃte an diesen Tagen ein erhebliches Standvermögen zeigen, zumal auch noch weltliche Feiern zu bewältigen waren wie die 'Festfeier' zu Hitlers Geburtstag, die man in der alten Bischofsstadt Freising abhielt. Die klassische Stätte für den Einklang von Feiern und Trinken ist die Theresienwiese. Daran änderte sich auch nichts, als Hitler Ehrenbürger von München (1993) und das Oktoberfest zum GroÃdeutschen Volksfest wurde (1938). Eine volkskundlich betreute Ausstellung zum Thema 'So feiern die Bayern' zeigt folgerichtig eine Figur in Miesbacher Tracht, die statt der Nase einen Zapfhahn aus Messing im Gesicht trug.
Ein Fest gilt als eröffnet, wenn 'angezapft' ist. Das Anzapfen besorgt der Gemeindevorsteher. Er ist der principal feast-giver, weil er die Verfügungsgewalt über den Holzhammer besitzt, mit dem angezapft wird. Alle Volksfeste sind seit 1977 gesetzlich geschützt, sie können nicht mehr verboten werden. Das gilt für die beiden Plärrer in Nürnberg und Augsburg ebenso, wie für das gigantische Bierfest im niederbayerischen Karpfham, zu dem Fremde keinen Zutritt haben. Bei allen Volksfesten wird ein möglichst hoher Bierkonsum angestrebt. Dazu ist es nötig, die Raumblase in den Zelten zu minimieren, um den Effekt des Alkohols zu optimieren. Ein Fest wird dann als erfolgreich angesehen, wenn es viele 'Räusche' gegeben hat und als besonders lustig eingestuft, 'wenn sich was rührte'. Konventionell betrachtet man das Einstechen des Messers bis zum Heft als SpaÃ, danach wird es ernst. Unausgesprochen sind die Bayern davon überzeugt, daà ihnen der Tod nichts anhaben kann, solange sie ihr Bier bekommen."
Aus:
McCormack R.W.B.: Tief in Bayern, Eine Ethnografie, Frankfurt 1991
10.01.03, Uli Piehler
|